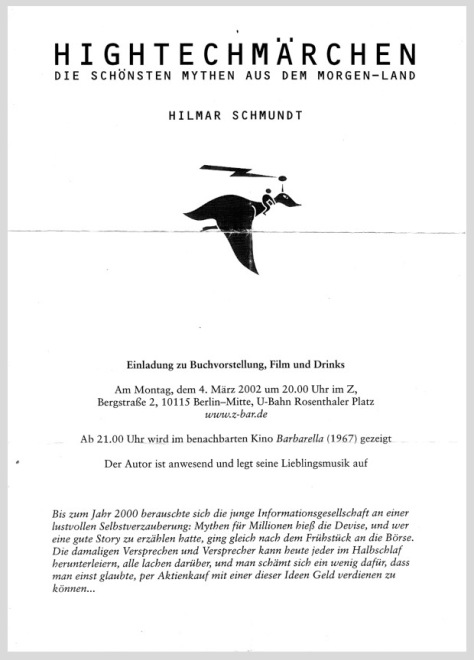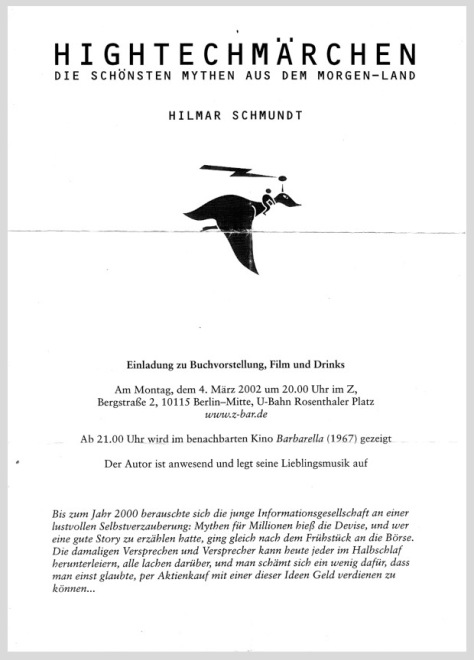Vor 15 Jahren kam mein Buch „Hightechmärchen – die schönsten Märchen aus dem Morgen-Land“ heraus.
Nun hat der Radiojournalist Jörg Wagner („Medienmagazin“ auf Radio 1) ein Experiment gestartet: Wie fühlt es sich an, einen Essayband aus dem Jahr 2002, der sich über die Technikmythen und die Internetfrömmigkeit von damals lustig macht, 15 Jahre später noch einmal herauskramt und durchblättert?
Ich habe die „Hightechmärchen“ mal eben hier auf Wattpad eingestellt.

Was lässt sich daran erkennen, wie fühlt es sich an, wenn so ein verstaubtes Fossil eine Welterklärung liefert: zeitlos und marsianisch-fremd wie ein Brief von Rip van Winkle? Nichts ist so peinlich wie die Zukunft von gestern.
Für mich persönlich war es skurril, meine eigene Stimme von damals zu hören, voller Dringlichkeit und viel zu schnell, als würde ich den Podcast mit mit doppelter Geschwindigkeit auf „Smartspeed“ abspielen. Hier kann man die Lesung von damals hören.
Dann setzt ein noch größeres Befremden ein.
NSA? Selbstfahrende Autos? Internet of Things? Twitter? Leistungsschutzrecht? Fake News? Taucht alles nicht mit einer Zeile auf in diesem völlig anachronistisch erscheinenden Text. Aber wirkt das veraltet? Oder schon zeitlos? Auch bei Wein gibt es ja diesen Punkt, an dem er umkippt von gereift zu…. Essig.
Sind diese Texte nach 15 Jahren Essig? Kann gut sein. Aber wenn das so ist: Zwingt uns das Säuerlich-Altmodische daran, als Leser stärker auf die Meta-Ebenen zu achten, auf Diskurse, die schon damals angelegt waren, und die heute einfach nur mit neuen Schlagwörtern aufgemotzt werden? Ich schlug damals eine „Stiftung Märchentest“ vor, ganz naiv, um den Technik-Aberglauben und all die Projektionen auf das Gerät („Die Computer sind schuld, dass ich nicht schlafen kann“) zu hinterfragen. Heute macht das Thema Fake News Schlagzeilen, und die diversen Methoden, um vergiftete, von Hass und Angst getriebene Lügenmärchen und Meme zu entlarven. Vor allem in diversen Vorratsdatenspeicherungs- und Fußfesseldebatten tauchen Motive auf, die ich im Computervirenkapitel nachzeichne.
Denkbar wäre es, mit Strategien, wie sie Claude Lévi-Strauss in der strukturalen Mythenanalyse verwendete, die Grund-DNA von Narrativen freizulegen: Märchen der Angst, Märchen der Gier, Märchen der Erlösung. Allerdings eben nicht Ursprungs-Mythen, die in ein fernes Gestern zurückreichen (im Sinne von Religion als „re-ligere“, als Rück-Verbindung), sondern nach vorne gedreht, als Märchen im Futur.
Insofern ginge es im Idealfall weniger um die Wiedervorlage eines alten Buches, sondern eher darum, durch das Buch hindurchzusehen auf die Mythenkränze im Futur, die es vorschlägt als Dispositiv, um den jeweils aktuellen Hightech-Hype der Woche zuverlässiger einzuordnen. Denn nicht die wahrere Geschichte gewinnt, sondern die besser erzählte. Ein solcher Ansatz für die Wiederauflage eines alten Textes wäre jetzt natürlich die ganz hoch gehängte Lesart, vielleicht sogar ein bisschen abgehoben. Kann sein, dass das Wiederlesen einfach Zeitverschwendung ist. Um das herauszufinden, hänge ich hier zumindest schon einmal das Einleitungskapitel an.
Ich selbst bin ja ein Fan von Büchern wie „Second Read“, die, wenn die große Aufregung sich gelegt hat, ein Thema noch einmal aufgreifen. Allerdings geht es bei „Second Read“ um kanonische Reportagen. Lassen sich auch aus normalen Gebrauchstexten durch Zeitverzögung, Retardierung und Doppelbelichtung Funken schlagen, nach dem Prinzip des Slow-Journalism-Magazins „Delayed Gratification“? Gibt es eine „Kunst der Doppelbelichtung„- nach dem Motto: Mit den zweiten liest man besser?
Was meint ihr, was meinen Sie? Welche Passagen finden sie heute im Vorwort von damals besonders skurril, peinlich oder vielleicht sogar erhellend?
Ich freue mich über sachdienliche Zuschriften, die ich gerne an den Autor weiterleite, der ich damals war.
Hilmar Schmundt
Berlin, d. 28. März 2017
Hightechmärchen – Die schönsten Mythen aus dem Morgenland
Vorwort: Stiftung Märchentest
Die Nuller Jahre und die Wiedergeburt der Großen Erzählungen
Der Tod der politischen Utopien gebiert technische. Hightechmärchen versprechen, dass jeder sich vom Aschenputtel zum Hans im Glück wandeln kann mit Hilfe der richtigen Technik. Technikmärchen unterhalten die Neugierigen und trösten die Technophoben. Sie heizen den Konsum an, schaffen neue Märkte und verändern so die Welt in ihrem Sinne. Einerseits vertuschen ihre Verheißungen wichtige Probleme. Andererseits regen sie die Fantasie an und eröffnen neue Möglichkeitsräume. Sie lassen sich nicht widerlegen oder ignorieren. Sondern nur bestaunen und genießen. Oder verreißen.
Wonniges Gedränge auf dem Basar der Zukünfte. Die Cebit verwandelt die Messehallen von Hannover alljährlich in eine Mischung aus Casino und Kathedrale. Über achthunderttausend Gläubige, Neugierige und Gierige sind zur größten Computermesse der Welt gepilgert, um sich überwältigen zu lassen von tausendundeinem Wunder der Technik aus dem Morgen-Land. „Tomorrow starts today“, locken Plakate. „Nicht hier. Nicht dort“, drohen die Papiertüten pickliger Kids. Oder locken sie? „Spreng die Grenzen deiner Phantasie“. Sie werben für die Playstation2, eine Spielkonsole, deren Prozessor so leistungsfähig ist, dass man damit Scud-Raketen steuern könnte, angeblich. „Entdecke einen unerforschten Ort. Willkommen im third place„, heißt es auf den Tüten. Lecker herausgeputzte Hostessen in Fantasieuniformen verteilen Handzettel und ihr Lächeln. Technische Fachkenntnis nicht erforderlich. Willkommen im wunderbaren Morgen-Land der hemmungslos entfesselten technischen Fantasie, die sich periodisch Bahn bricht auf Messen wie der Cebit, der Internationalen Funkausstellung in Berlin oder der Comdex in Las Vegas.
Ein fernes Donnern von Filmmusik kündigt den riesigen Pavillon von Sony an, eine Mischung aus Hirtenzelt und Kühlturm. Die beliebteste Jahrmarktsattraktion ist der kleine Aibo – nicht Mensch nicht, nicht Tier, sondern der Plastikgewordene Spieltrieb selbst. Neugierig drängt sich eine Menschentraube um den putzigen Gesellen, einen silbernen Roboterhund aus Hartplastik.
„Say hello, Aibo“, souffliert der Dompteur. Auf tattrigen Sensorpfoten führt das Tier ein Tänzchen auf, schwankend wie im Rinderwahn. Dann wedelt sein Schwanz, an dem eine Diode blinkt. Eine Melodie wie am Daddelautomat erklingt, und Aibo hebt eine Pfote zum Gruß. Applaus. Nach anderthalb Stunden ist der plastikgewodene Spieltrieb erschöpft und muss zurück an die Ladestation.
Aibo ist sozusagen ein trojanischer Hund. Dieser Computer auf Pfoten erhält seinen Input nicht über eine Tastatur, sondern vor allem über spezielle Streichelsensoren an Rücken, Schnauze und Kopf erfolgt. Als Output generiert er nicht Daten, sondern Emotionen, als sei er der beste Freund des Menschen. „Ist der nicht putzig“, schwärmt eine dauergewellte Mutti. „Aibo, fass!“, bellt ein Bengel. Hund und Herrchen, so heißt es, nähern sich im Verlauf des Zusammenlebens immer weiter an – doch wer an wen? „Aibo“ bedeutet Partner auf Japanisch. Das neueste Upgrade des Plastikpartners soll das Zusammenwachsen der beiden erleichtern: Die Software „Aibo Life“ erlaubt es dem Besitzer, den Anfangs ungeprägten Hund durch Streicheln und Strafen zu erziehen. „Aibo ist lebenslustig wird er gelobt und Aibo ist ruhig wird er gescholten“, heißt es im eigenwilligen Sonysprech im Internet unter der Rubrik „Beibringen von Disziplin“. Der Trick: Des Pudels Kern ist eine Speicherkarte, die sich die erteilten Lektionen „merkt“.
„Komm spiel mit mir“, lockt auf Aibos Cebit-Stand ein Schild an der Wand, „Bitte nicht berühren“, warnt ein zweites direkt an der Manege. Die beiden Befehle schließen sich nicht unbedingt aus. Denn was hier zählt, ist die Fantasie. Aus plumpen Zählmaschinen sind Erzählmaschinen geworden. Jeder Technikmythos hat seinen Preis, das gilt im Großen wie im Kleinen. An den Börsen, wo Aktien oft zu Fantasiepreisen gehandelt werden, geht es um Milliarden. Aibo dagegen sozusagen nur ein kleiner Fisch und geht für nur tausenfünfhundert Euro über den Ladentisch. Die Lernsoftware wird übrigens extra berechnet. Dennoch rissen sich die Kunden um das garantiert stubenreine Haustier, als es zum Jahrtausendwechsel auf den Markt kam, in wenigen Monaten hatten 45.000 Aibos ein neues Zuhause. Und eine Heimstatt in der kollektiven Fantasie derer, die leer ausgingen.
Die neueren Aibo-Versionen können 75 Befehle verstehen, die sich frei kombinieren lassen mit sechs „Instinkten“ wie Schlafen oder Spielen, und acht „Emotionen“ wie fröhliches Winken oder schmollendes Wegtrollen. Damit erobert die Künstliche Intelligenz die Wohnzimmer: das Prinzip lernfähiger Maschinen. Aibo gehört zu einer neuen Generation von Rechnern, die nicht Zahlen, sondern Gefühle verarbeiten.
Bald fanden findige Hacker heraus, wie sich der Pudel umprogrammieren lässt. Auf der Website von Aibopet tauschten sie Programme aus, die den Hund zu einer Hündin oder Katze mutieren lassen. Sony fürchtete den Kontrollverlust über die kollektive Kreativität und drohte im Herbst 2001 mit rechtlichen Schritten. Gemäß der Anleitung „Aibo ist ruhig, wird er gescholten“, gaben die Fans sofort nach – an die Leine gelegt wie gut dressierte Herrchen. Wieder war die öffentliche Aneignung eines Hightechmärchens auf den Hund gekommen.
Eine lächerliche kleine Episode aus den Nuller Jahren des neuen Jahrtausends, eigentlich kaum der Rede wert. Doch Aibo ist mehr als ein Spielzeug. Sein tattriger Pas de Deux mit den Emotionen und Träumen des Publikums ist Thema dieses Buches: Die Selbstverzauberung der Informationsgesellschaft auf dem glatten Parkett der Hightech. Den dramatischen Seiltanz der Fantasie zwischen Aufbruch und Absturz, Kreativität und Kontrolle, Spiel und Dressur. Und der Preis, der für Ausrutscher und Fehltritte unweigerlich zu zahlen ist.
„Es wird einmal, in nicht allzu langer Zeit“ – so beginnen Hightechmärchen. Es wird einmal die Technik alles umwälzen und unser Leben in ein besseres verwandeln. Tomorrow starts today. Es wird einmal die Technik so zuverlässig, schnell und billig sein, dass sie den Mensch wie im Schlaraffenland umsorgen wird. Alljährlich, wenn die Cebit im März ihre Tore zur Zeitreise ins wunderbare Morgen-Land technischer Errungenschaften öffnet, reißen sich die Zeitungen und Sender darum, die barocken Phantasien der Hightech-Märchenonkels in epischer Breite auszuwalzen. Unsere Kleidung wird elektronisch vernetzt durch sogenannte „Wearables“, unsere Kühlschränke werden mit uns sprechen und die verbrauchten Lebensmittel automatisch per Internet nachbestellen, die Pendlerströme lösen sich auf, weil Telearbeit von daheim die Anfahrt ins Büro erübrigt, die globale Demokratie setzt sich spontan per Internet durch, der Mensch besiedelt den Mars, nimmt die Evolution selbst in die Hand, indem er seinen eigenen Körper mit Hilfe von Gentherapien umbaut, und schafft nebenher noch den Tod ab. Kurz: Das Morgen erscheint als magische Märchenwelt, in der alles anders ist und vieles besser, als wir es heute kennen.
Die Erfahrung widerspricht den Technikträumen – das macht sie ja so faszinierend. Endlich einmal auszublenden, dass Rechner in der banalen Realität dazu neigen, gerade dann abzustürzen, wenn ein wichtiges Dokument fertig ist, dass Kabel nicht passen, wenn die Zeit drängt, und dass Handyakkus dazu tendieren, immer dann leer zu sein, wenn ein wichtiger Anruf drängt. Doch mit derlei Einwänden wird man einem wunderschön schillernden Genre nicht gerecht. Denn Hightechmärchen sind mehrdeutig. Sie erfüllen vielerlei Bedürfnisse. Sie bieten Unterhaltung für die Erlebnisgesellschaft. Trost für die Technophoben. Verkaufsargumente für die Industrie. Sie vereinfachen das Überangebot und erhöhen gleichzeitig den Wunsch nach mehr, weil sie die Fantasie anregen. Schließlich sind Träume von einem besseren Morgen die Grundlage dafür, dass tatsächlich wunderbare Erfindungen entstehen. Die folgenden Reportagen und Aufsätze sind Expeditionen zu den Großbaustellen dieses geheimnisvollen Morgen-Lands, wo Fantasie und Technik verschmelzen. Besuche bei den Architekten visionärer Wolkenkuckucksheime und plumper Investitionsruinen. Und Spaziergänge durch ein paar wenig betretene Auswege aus dem selbst erschaffenen Labyrinth des Größenwahns.
Das Ende der Utopien findet nicht statt
Eigentlich sollte es ja 1989 schon soweit sein: Die Geschichte ist aus, wir geh’n nach Haus zu Familie, Fernseher und Freizeitspaß, so der amerikanische Historiker Francis Fukuyama in seinem Buch „Das Ende der Geschichte“. Mit der Konfrontation von Kapitalismus und Sozialismus endete für ihn die Geschichtsschreibung, wie wir sie kennen. Von nun an war Posthistoire angesagt. Ein nachideologisches Zeitalter, das ohne die Polit-Märchen vom kapitalistischen Paradies oder vom sozialistischen Neuen Menschen auskommt. Fukuyamas These war ebenso verstiegen wie unoriginell, schließlich konnte schon damals jedes Erstsemester die Analyse vom „Ende der Großen Erzählungen“ herunterbeten, die der französische Philosoph Jean-François Lyotard 1979 veröffentlichte. Auch Joachim Fest stimmte Anfang der Neunziger in den Chor ein und diagnostizierte noch einmal, sicher ist sicher, das „Ende der utopischen Systeme“: „Eine kaum übersehbare Hinterlassenschaft an Theorien, Denkräumen und Erwartungen, an Rauschmitteln, Ausflüchten und Tröstungen geht verloren. Niemand vermag zu sagen, wo ein Ausgleich dafür herkommen soll.“
Zehn Jahre später ist klar: Große Erzählungen sind so populär wie selten zuvor. Vor allem, wenn sie mit Flachbildschildschirm oder tausendundeinem Klingelton daherkommen und jeder Kunde seine eigene kleine Hauptrolle spielen darf. Die Informationsgesellschaft verzaubert sich selbst, denn reine Information ist ungenießbar ohne eine spannende Story, die alles grundiert. Jede kleine Dotcom-Klitsche beherrscht heute den Slang des technisch-Erhabenen. Ein Computerspiel verspricht den Aufbruch ins Reich der Fantasie selbst: Welcome to the Third Place.
Die Informationsgesellschaft ist vor allem eine Erzählgemeinschaft. Ihre Erzählform ist das Futur. Es wird einmal. Das große Mañana. Das freie Prophezeien ist zum Volkssport geworden. Nie gab es so viele Zukunftsgeschichten wie nach dem angeblichen Ende der Geschichte. Der Schlaf der politischen Utopien gebiert technische.
Aus dem Traum einer besseren, gerechteren Gesellschaftsordnung, von „Zuckererbsen für jedermann“, wie Heinrich Heine im Wintermärchen schrieb, ist der Glaube an die überlegene Technik geworden, die für den Einzelnen dasselbe leisten kann: die Befriedigung aller körperlichen und seelischen Bedürfnisse durch Teleshopping, Cybersex und das Schwanzwedeln irgendeines besten Freundes aus Plastik, bis dass die Akkuladung euch scheidet. Die Zuckererbsen können entweder am Rechner simuliert oder im Genlabor geklont werden.
Jede Zeit erzählt sich die Märchen, die sie verdient. Sie sind heute die Sprache, in der die Zukunft verhandelt wird. Verliert ein Hightechmärchen seine Wirkung aufs kollektive Unbewusste, wird es meist umformuliert und taucht als neue Story irgendwie und irgendwo anders wieder auf. Wer die Zukünfte von Gestern kennt, und weiß, was aus ihnen geworden ist, kann auch mit den Verheißungen für das Morgen besser umgehen. Und sie werden kommen. Mindestens so bizarr und lustig wie die, die wir kennen: Das papierlose Büro. Das intelligente Haus. Die Besiedelung des Mars. Der endlose Boom der Hightechaktien. Ein wunderbarer Mythenkranz, der bislang ungeordnet verstreut liegt zwischen Messegesprächen und Manifesten, Fachartikeln und Sciencefiction-Stories.
Stifung Märchentest
Der Technikredakteur lebt im Rhytmus der Jahreszeiten, ähnlich wie einst der Ackerbauer. Die gelbe Altpapierkiste in der Redaktion zeigt mir an, wenn die Cebit naht, das alljährliche Fest der Hightechmärchen. Dann stapeln sich die Pressemitteilungen zu technischen Revolutionen und Durchbrüchen und ganz unglaublichen Zukünften auf dem Schreibtisch. Die Sichtung der Pressemitteilungen und Testgeräte dauert oft eine halbe Stunde pro Tag. Das meiste ist billigster Infoschrott in Wort und Gerät. Anfang 2001 war eine Digitalkamera von Kodak dabei, angeblich speziell für Jugendliche entwickelt, die zwar über einen MP3-Musikplayer verfügt und kleine Filmchen aufnehmen kann, die aber keinen Blitz hat. Wo doch das beste ist, auf Partys zu fotografieren. Das Ding heißt auch noch mc3 (Sprich: MC hoch drei), was an Albert Einsteins Relativitäts-Formel erinnern sollte. Alles ist eben relativ, nur die Blödheit mancher Konstrukteure ist absolut.
Für derartig manifeste Fehlkonstruktionen gibt es zwei Orte: Erst das gnadenlose Testlabor von Computerbild, c’t und Stiftung Warentest. Und dann den Sondermüll. Doch wer mistet den verbalen Überbau aus, der jede dieser Technik-Trotteleien begleitet? Ungefiltert läuft das rasende Gefasel der Hightechindustrie von Mund zu Ohr zu Hirn und sedimentiert sich schließlich auf den Schreibtischen der Redaktionen wie klebriger Klärschlamm.
Manchmal, wenn ich vor Gram über meinem Stapel Hightech-Trash zusammensinke, erscheint mir wie im Tagtraum eine neue, mindestens tausend Mitarbeiter starke Institution mit Sitz im Gebäude der Vereinten Nationen: die Stiftung Märchentest. Sie sichtet und bewertet alles, was den lieben langen Tag an schwachsinnigen Prognosen abgesondert wird. Nur wirklich begeisternde Meldungen gelangen auf meinen Schreibtisch. Manchmal ein Fax, auf dem nur ein einziges Zitat steht, zum Beispiel der von Ray Bradbury: „Die Leute bitten mich, die Zukunft vorherzusagen, während ich versuche, sie zu verhindern.“ Um derlei Sätze kann man im Geiste herumschlendern wie um eine Skulptur von Brancusi. Oder um einen der alten Superrechner aus dem Hause Cray, der wie ein kleiner Kühlturm im Wohnzimmerformat aussah, mit einer rot gepolsterten Sitzbank ringsum, die angenehm vorgewärmt war von der Denkarbeit der Prozessoren in ihrem Inneren. Die Stiftung Warentest kann leider nur testen, was es schon gibt. Wer kümmert sich um all die Hightechmärchen, die davon handeln, was sein könnte oder sollte? Die Erzählungen aus dem Morgen-Land leisten gedankliche Laborarbeit, lenken die Fantasie, vereinfachen die wirre Welt der Forschung und Technik und öffnen gleichzeitig neue Perspektiven. Ohne die Fantastereien von Leuten wie dem exzentrischen Mathematiker Alan Turing, der schon vor fünfzig Jahren einfach aus Spaß riesige Rechenmaschinen mit Liebesgedichten fütterte, gäbe es wahrscheinlich bis heute kein Internet, keine ABS-Bremse, keine Digitalkameras. Hightechmärchen sind eine der wichtigsten Ressourcen der Informationsgesellschaft. Doch eine Qualitätskontrolle gibt es bislang nicht. Dadurch droht die technische Fantasie in Verruf zu geraten.
Der Telefontest
Die Kriterien der Stiftung Märchentest wären simpel. Zuerst wird jedes neue Hightechmärchen dem Telefontest unterzogen. Der Telefontest geht so: Das Hightechmärchen vom Cyberkrieg landet zum Beispiel auf dem Tisch. Seit ein paar Jahren wird fast jeder bewaffnete Konflikt angeblich von einem „Cyberwar“ begleitet, und jedes Mal ist wieder das erste Mal. Wenn Palästinenser und Israelis sich erschießen, wenn im Kosovo Bomben fallen, wenn China ein US-Flugzeug auf einer Militärbasis festhält, immer wird die Story vom Krieg ohne Blut und Bomben erzählt. Seit Jahren schon warnen selbsternannte Experten in glühenden Farben vor dem Cyberkrieg. Doch seltsamerweise wirken die Bedrohungsszenarien um so hysterischer, je älter sie sind. Cyberterroristen würden das Chaos des Jahrtausendfehlers nutzen, um die Infrastruktur der USA lahmzulagen, warnten vor Jahren Politiker und Sicherheitsexperten. Nichts passierte. „Der Cyberkrieg kommt“, verkündeten Mitarbeiter der Rand Corporation 1993. Die Cyberfront blieb ruhig. Ein „elektronisches Pearl Harbor“ stehe direkt bevor, warnte gar der Sicherheitsexperte Winn Schwartau. Das ist zehn Jahre her. Als Beispiel werden meist ein paar Websites genannt, die von pickligen Schulkindern manipuliert worden sind, was „Web defacement“ genannt wird. Also los geht der Telefontest: Jeder Internet-Begriff wird einfach durch das Wort „Telefon“ ersetzt. Es ginge in diesem Fall um einen Telefon-Krieg und würde sich etwa so lesen: Chinesische Anrufer haben eine Telefonnummer des CIA stundenlang mit Klingelstreichen geneckt. Das klingt, gelinde gesagt, absurd. So absurd, wie die Legende vom Cyberkrieg häufig ist. Natürlich werden Kriege schon lange mit elektronischen Mitteln geführt, spätestens seit es Telegrafen, Radar und Störsender gibt. Das Herummuckeln an Internetseiten gehört nicht dazu.
Der Telefontest ist nicht nur ein Seziergerät, um Hirngespinste von Visionen zu unterscheiden. Er ist selber eine Vision, ein Vorgeschmack auf die Zeit, wenn Rechner keine Sau mehr interessieren und kein Hahn mehr nach den Vorsilben Hyper und Cyber kräht. Die neuen Medien sind alt geworden, und in ein paar Jahren sind Mikrochips und Datennetze hoffentlich so alltäglich, zuverlässig und unsichtbar, dass fast niemand mehr etwas über sie wissen will. Den Siegeszug des Computers erkennt man daran, dass er unsichtbar wird. Heute diskutiert schließlich auch niemand leidenschaftlich über das Auswechseln von Glühbirnen oder Kloschüsseln.
Euphoriker, Apokalyptiker und Fundamentalisten
Nach dem Telefontest würde die Stiftung Märchentest den Interessen-Check durchführen: Wer erzählt was und warum? Drei große Gruppen von Hightech-Märchenonkels beherrschen derzeit den Meinungsmarkt. Nennen wir sie einfach Euphoriker, Apokalyptiker und Fundamentalisten.
Das neue Musikformat MP3 bietet sich als Beispiel an. Die Euphoriker von der Internet-Musiktauschbörse Napster sangen natürlich das Hohelied der digitalen Musik. Das Märchen der Euphoriker handelt ja von der allgegenwärtigen Musik, die nichts kosten darf. Das gefällt den Internetnutzern auch, die von den Euphorikern darauf konditioniert worden sind, für Internetinhalte nichts zu bezahlen.
Doch da haben sie die Rechnung ohne die Apokalyptiker gemacht. Die singen ein anderes Lied. „Copy Kills Music“ jammern die Fantastischen Vier im Chor mit der Musikindustrie, die allein in Deutschland über Einnahmeverluste von über 1,5 Milliarden Euro klagt – ohne konkrete Belege liefern zu können. Das Brennen von CDs und der Musiktausch im Internet töte die Musik, weil es die Musiker um ihre Einnahmen bringt. Das ist natürlich Quatsch. Schon in den Siebzigern stimmte die Musikindustrie dieses Liedchen an, als Cassettenrekorder das Mitschneiden aus dem Radio ermöglichten. Die aktuelle Absatzkrise begann vor der weiten Verbreitung von CD-Brennern und Internet-Tauschbörsen und ist großenteils hausgemacht. Aber die Jammertirade ist eingängig wie ein Ohrwurm. Und tödlich wie eine Sirenengesang. Denn hier werden die Kunden als Piraten und das Internet als bedrohlichen Dschungel vorgestellt. Jahrelang verhinderte das Seemannsgarn über die Musikpiraten, dass die Plattenfirmen eigene, gut sortierte, aktuelle Bezahldienste im Internet aufbauen. Stattdessen setzten die „Big Five“, die fünf großen Musikkonzerne, mit Prozesslawinen und Kundenbeschimpfung gegen die Musik im Internet vorzugehen.
Widersprüchliche Technikmärchen schaukeln sich oft gegenseitig hoch wie das Gebrüll von Schlachtenbummlern im Fußballstadion. Wenn in der Nordkurve gejohlt wird, muss die Südkurve antworten. „Die Plattenfirmen befinden sich im Todeskampf mit dem Internet„, salbaderte etwa John Perry Barlow, selbst ernannter Netzbürgerrechtler und ehemals Texter für die Band The Grateful Dead. So wie er erzählen sich allerlei radikale Technikfundamentalisten das Hightechmärchen von der technischen Überlegenheit der Hacker und dem Eigensinn des Netzes. Es gebe keinen digitalen Urheberrechtsschutz, der sich nicht knacken lässt, lautet ihr Mantra. „Das ist reine Anarchie“, prahlt Ian Clarke, ein irischer Student, der das Tauschsystem Freenet entwickelt hat, ein dezentrales Netz, das sich tatsächlich nicht ohne weiteres abschalten lässt. Aber dafür ist Freenet unendlich langsam und instabil und so nervig, dass es Musikfreunde in hellen Scharen in die offiziellen Plattenläden treiben dürfte. Die Plattenindustrie sollte eigentlich frohlocken über derartige Musikpiraten, denn Freenet wäre keine Konkurrenz für einen gut gemachten Online-Musikdienst, der pro Song einen Euro verlangt. Hightechmärchen können das Fundament für neue Märkte, Techniken und Visionen sein – und diese auch zum Einsturz bringen. Derzeit drehen sich Euphoriker, Apokalyptiker und Fundis munter in ihrem eigenen Mythenkreis herum, wie ein fehlerhafter Aibo-Hund, der seinen eigenen Schwanz jagt, bis er sich heillos in seiner eigenen Hundeleine verheddert hat. Wenn sich der Roboterhund aufhängt, hilft nur ein Neustart. Ähnliches gilt auch für das Genre der Hightechmärchen im neuen Jahrtausend.
Bruder Grimm 2000 und der Entrüstungswettlauf
Zum Schluss könnten die Fachleute der Stiftung Märchentest die Maschinenerzählungen als Erzählmaschinen auffassen und in bester Hackertradition auseinandernehmen: Was ist der Input dieser Erzählmaschine, was der Output? Erst so wird ein kreativer Umgang mit (Kultur)-Techniken möglich. Der Plastikpudel Aibo zum Beispiel wird mit Zärtlichkeit und Streicheleinheiten an seinen Schmusesensoren gefüttert. Und mit dem uralten Menschheitstraum, eine perfekte, unsterbliche, bedürfnislose Liebesmaschine zu erschaffen. Aibos Output ist Trost an einsamen Winterabenden, und natürlich das Gefühl, mit dem Erwerb des dreitausend Mark teuren Spielzeugs zu einer beneidenswerten Technik-Avantgarde zu gehören. Wenn erst die Anatomie eines Hightechmärchens erkundet ist, fällt es nicht schwer, eine Alternativerzählung zu entwickeln. Re-engineering heißt dieses Prinzip.
Ein derartiges Reengineering von Mythen hat eine lange Tradition. Die deutsche Leitkultur, was immer das sein mag, ist nur eines von vielen Beispielen: Wer hierzulande Märchen sagt, meint meistens die Gebrüder Grimm und den Weltbestseller, die „Kinder- und Hausmärchen“, die ab 1812 erschienen sind, nach langjährigem Sammeln. Die modernen Hightechmärchen haben mit den Grimmschen Märchen wenig gemeinsam und es wäre schwierig, Parallelen zu Froschkönigen, Bremer Stadtmusikanten und Gänsemägden zu ziehen. Nur ihre Funktion ist damals wie heute eine ähnliche: Erwartungen, Rauschmittel, Ausflüchte und Tröstungen zu formulieren. Grimms Märchen erfanden eine gemeinsame Vergangenheit für all die zerstrittenen, von den Napoleonischen Kriegen verwüsteten deutschen Kleinstaaten. Die Hausmärchen sollten über die Wirrnisse zu Beginn des 19. Jahrhunderts hinwegtrösten und das Gefühl für eine virtuelle Heimat vermitteln, die es so noch nicht gab. Ihre mythische Vergangenheitsform war auch als Fundament für ein geeintes Deutschland gedacht, das erst 1848 in der Paulskirche gegründet wurde. Jacob Grimm war damals Abgeordneter. Märchen sind Fantasiegespinst und Handlungsprogramm, Folklore und Vision in einem.
Heute sind die Märchen vom Gestern ins Futur gerutscht. „Es war einmal“ verwandelt sich in „Es wird einmal“. Diese Verpflanzung der Hightechmärchen in ein Morgen-Land bedeutet mehr als nur einen Tempus-Wechsel. Jeder Zuhörer ist als Mitspieler und Hauptperson gefragt, wie in einem Computerspiel. „Du stehst auf einem offenen Feld westlich von einem weißen Haus mit einer zugenagelten Tür“, so begann die erste Szene des Computerspiels „Zork“, ein sogenanntes Text Adventure, durch das sich die Spieler mit kurzen Tastaturbefehlen hindurchmanövrieren mussten. Zork wurde schon 1977 von drei Informatikstudenten am MIT bei Boston entworfen. Die Erzählstrategie des interaktiven Computermärchens wirkt auch in den Hightechmärchen der Nuller Jahre fort. Vier Bausteine treiben als Motor die meisten Hightechmärchen an: Ein Wunsch, den es zu erfüllen gilt, Hindernisse wie die vernagelte Tür, die es zu überwinden gilt, eine hilfreiche Zaubertechnik und die Hauptfigur namens „Ich“. Spielte sich in Grimms Märchen die Handlung in einer fernen Vergangenheit ab und im Computermärchen Zork im Rechner, so gilt heute dagegen der gesamte Alltag in der Informationsgesellschaft als zauberhaftes Morgen-Land, durch das jeder Kunde als Hauptfigur irrt auf der Suche nach Erfüllung. „ich habe einen traum“, warb im Herbst 2001 das Internetkaufhaus namens Quam.de für „24-h-shopping per handy“ in doppelseitigen Zeitschriften-Anzeigen. Die Einstiegsszene: „ich liege am strand und sehe eine frau mit hübschen badelatschen“ steht in internet-typischer Kleinschreibung als Bildunterschrift zum Foto einess Liegestuhls an einem Strand. „ich bleibe liegen. und kaufe mir die gleichen. Quam. i have a dream.“ Das Motto spielt auf die Utopie des schwarzen Bürgerrechtlers Martin Luther King an, der von einer besseren Gesellschaft träumte. Quam greift diese politische Utopie auf und verspricht der Hauptperson „Ich“, die Welt in ein digitales Schlaraffenland zu verwandeln, halb Traum, halb Computerspiel. Dass die Postzustellung der Badelatschen Tage dauern dürfte, wenn sie überhaupt im Angebot sind, spielt keine Rolle in diesem irrealen Rollenspiel. Hier geht es um Fantasy.
Ist das nun gut oder schlecht? Egal, es ist eben so. Die Moralfrage wäre nicht abendfüllend.
Wer sich nun auf den Entrüstungswettlauf gegen derlei Markenmärchen einlässt, hat schon verloren.
Für den, der sie weder verbieten noch bekämpfen noch ignorieren will, sondern sie ernst nimmt, bedeuten Hightechmärchen Freiheit, Reichtum und Unabhängigkeit. Nach diesem Prinzip schufen auch die Gebrüder Grimm ihr Opus. Sie mäkelten nicht gegen die Besatzungsmacht Frankreich, sondern erzählten ihre oft brüllend komischen Märchen aus der Vorvergangenheit einer fiktiven Kulturnation. Bis ihr Märchen wahr geworden war. Ein gelungener Hack, würde man heute sagen.
Auch für die heraufdämmernde Wissensgesellschaft sind Märchen von strategischer Bedeutung. Sie stehen nicht im Widerspruch zum Aufbruch in neue Wirtschafts- und Lebensformen, sondern bilden ihr Fundament. Vielen Börsenanalysten, Jungunternehmern, Politikern und anderen „Symbolanalytikern“, die mit Informationen und Meinungen ihr Geld verdienen, ist das Bewusstsein für die Wirkungsmächtigkeit von Mythen abhanden gekommen. Das könnte sich bitter rächen. Daher dieses Buch. Die folgenden Kapitel sollen am Beispiel handverlesener Hightechmärchen mögliche Lesarten und Alternativen skizzieren. Jeder ist sein eigener Märchentester. Die einzelnen Kapitel sind in sich geschlossen und können daher in einer beliebigen Reihenfolge gelesen werden.
Fastforward: Wie geht es weiter?
Das erste Kapitel handelt von Tod und Wiedergeburt eines Märchens: Die bemannte Raumfahrt hat ein Imageproblem. Jahrelang funktionierten die bemannten Raketen als Transzendenzmaschine, dem Blick vom All auf die „blaue Murmel“ der Erde wurden magische Kräfte zugesprochen, die zu Weltfrieden, Ökologie und Gottesfurcht führen. Jahrzehntelang wurden Unsummen in dies leicht durchschaubare Märchen gepumpt, mit mehr als zweifelhaftem Nutzen. Doch als die bemannte Raumstation ISS, deren Aufbau und Betrieb in den nächsten 15 Jahren vermutlich rund 90 Milliarden Euro verschlingen dürfte, im ersten Jahr des neuen Jahrtausends von den ersten Astronauten betreten wurde, hielt sich das Interesse in Grenzen. Stattdessen entflammte sich die Fantasie der Öffentlichkeit spontan am Weltraumausflug des sechzigjährigen Multimillionärs Dennis Tito, des ersten zahlenden Weltraumtouristen. Das Rittermärchen vom furchtlosen Astronauten-Supermann wurde nicht von Wissenschaftlern oder Rechnungsprüfern widerlegt. Es wurde einfach verdrängt von der Aussicht auf den Pauschaltourismus ins All und die Verheißung, dass bald jeder sein eigener Spacecowboy sein kann.
Aber heute braucht niemand mehr ins All zu fliegen, um sich als Held zu fühlen, darum geht es im „Märchen vom Unternehmer als Revoluzzer“. Viele Vertreter der New Economy kaschierten die Schwäche ihrer Businesspläne, indem sie das Revolutionärsgeschwafel radikaler Gesellschaftskritiker kidnappten und damit Finanziers und Börsen beeindruckten. Dann kam der Crash, die kollektive Börsenhysterie zerplatzte, und Katerstimmung machte sich breit. Die Unternehmer als Revoluzzer hatten durch den Verfall der Aktienwerte tatsächlich eine billionenschwere Umverteilung durchgeführt: von den Dummen zu den Schlauen, von den gierigen Träumern zu denen, die nicht nur Bilanzen, sondern auch Hightechmärchen lesen können. Auch Banker brauchen Märchen, und was damals fehlte war ein Bruno Bettelheim für Börsianer.
Im Kapitel „Amnesie International – das Märchen vom digitalen Weltgedächtnis“ geht es ebenfalls um einen rührend Naiven Glauben. Nicht an Profit, sondern an die Unsterblichkeit des Geistes in Form digitaler Speichermedien. Während die Euphoriker schon vom kollektiven Superhirn träumen, verhallen die Warnungen von Archivaren und Techniker meist ungehört: Datenbänder, CDs und Festplatten zerfallen, veralten und werden schon nach wenigen Jahren unlesbar. Die Gegenwart könnte dereinst zur am wenigsten dokumentierten Epoche der Neuzeit gehören, warnen Spezialisten. Und da nicht alle Daten aktualisiert, gepflegt und restauriert werden können, muss heute aktiv entschieden werden: Was könnte die Urenkel interessieren? Was können, dürfen, müssen wir vergessen, um das wenige Wichtige gezielt zu erhalten?
Jahrelang wurde der Cyberspace als ein Reich der unbegrenzten Möglichkeiten gelobt, daran erinnert das Kapitel „Information an Ihrer Fußspitze“. Schon lange widersprachen akademische Cybergeografen dieser Sicht und beschrieben mit bunten Karten, wie eng verknüpft der Datenraum mit der realen Welt ist. Mit Beginn der Nuller Jahre stellte die Computerbranche fest, dass das Bild vom ortlosen, endlosen Datenraum die Online-Kunden verschreckt. Plötzlich schlug das Märchen in sein Gegenteil um: Heute gelten vor allem die mobilen Handy-Datendienste als perfektes Navigations- und Überwachungsinstrument.
Nicht nur Startup-Unternehmer, auch Weltverbesserer unterhalten sich mit eigenen Hightechfantasien, das zeigt das Kapitel „Betriebssystemkritik“. Linux, ein kostenlos erhältliches Betriebssystem für Computer, wird seit Jahren als Allheilmittel gepriesen gegen die Monopolstellung von Microsoft auf dem Privatkundenmarkt. Ein wunderschönes Märchen, dessen Verwirklichung leider immer wieder daran scheitert, dass Linux ein Profisystem ist, das auf dem Rechner von Otto-Normalnutzer nichts zu suchen hat, weil es zu anspruchsvoll ist. Seine eigentliche Stärke liegt im radikalen Offenlegen aller Schwächen: Mehrere tausend Fehler sind im Internet schonungslos veröffentlicht. Die ärgsten Fehler können daher schnell beseitigt werden, weshalb Linux insgesamt stabiler läuft als alle anderen. Die Fehlerkultur wird so zum Erfolgsfaktor.
Am faszinierendsten von allen sind natürlich die Horrormärchen – allen voran das „Märchen vom finalen Killervirus“. Das Internet wird lahmgelegt! Schon ein Mausklick genügt, und schon ist der Rechner ein Haufen Sondermüll! Alle paar Monate scheucht ein Kartell aus Sicherheitsberatern und Softwarefirmen die nichtsahnende Öffentlichkeit auf mit haarsträubenden Virenwarnungen. Das Märchen vom Killervirus ist so erfolgreich, dass sich bereits eine ganze Spaßkultur der Falschmeldungen im Internet gebildet hat: Sogenannte Hoaxes warnen vor Computerviren, die es gar nicht gibt. Und diese Hoaxes wiederum werden durch die Panik, die sie verbreiten, selber zum Problem. Der Alltag der Virenschreiber und ihrer Gegner dagegen ist banal und weitgehend industrialisiert: Lieblos klicken Nichtprogrammierer aus Bausätzen neue Plagegeister zusammen, die vollautomatisch von Großrechnern weggeputzt werden. Am nachhaltigsten lässt sich die lästige Virenflut bekämpfen, sagen Fachleute, indem man den Mythos des genialen, bösen Virenschreibers zerstört. Die Erforschung und Umdeutung von Hightech-Gruselmärchen könnte langfristig zu einem wichtigen Instrument der Datensicherheit werden.
Selbst die Internetverwaltung selber fußt auf wenig mehr als einem wackligen Gründungsmythos, das zeigt das „Märchen von der virtuellen Totaldemokratie“. Seit vielen Jahren schon geistert das Ideal der virtuellen Gemeinschaft durchs Internet. Verlassene globale Dörfer und virtuelle Geisterstädte säumen seinen Weg. Doch in den Nuller Jahren droht sich der Mythos vom besseren Gemeinwesen im Netz endgültig zu Tode zu siegen, nicht zuletzt durch eine endlich verwirklichte Internetwahl, ein Urnengang im doppelten Sinne: Die Wahlbeteiligung lag unter einem Promille. Die Kandidaten nahmen die Wahl an.
Viele dieser Märchen hatten nur eine geringe Halbwertszeit, zum Glück. Sie klingen grotesk wie die Hits vom letzten Sommer. Und dennoch lohnt es sich, noch einmal zuzuhören. Denn nach den Weltraummärchen und den Internetfabeln drängt sich ein neues Thema in den Vordergrund: Die Gengeschichten. Diesmal geht es ums Ganze: Der Mensch ist entschlüsselt, so das aktuellste Hightechmärchen, das noch viele Jahre die Hitparade anführen dürfte. Die Genforschungsindustrie verspricht vollmundig die Abschaffung von Krankheit und Tod, noch bevor das Erbgut überhaupt vollständig kartiert ist. Das ist in etwa so glaubwürdig wie ein ABC-Schütze, der kaum buchstabieren kann, aber schon einen Autorenvertrag bei Suhrkamp unterschreiben will, und zwar Hardcover. Aber das Märchen von der Beherrschung des Lebenscodes ist all zu verlockend. Während die meisten anderen Hightechmärchen leicht zu durchschauen sind, erfordert der neue Mythenkranz, der sich um den Lebenscode rankt, ein Höchstmaß an Fantasie, Vorwissen und gesundem Menschenverstand. Sonst droht auch bei diesem Hightechmärchen wieder ein fataler Absturz wie in der Elektronikbranche.
Die leidvollsten Erfahrungen mit Lügenmärchen, Hochstapeleien und falschen Prophezeiungen haben die Futurologen, die sich heute lieber Szenariotechniker nennen, um sich einer langen Geschichte voll halbseidener Prophezeiungen zu entwinden. Zukunftsforscher taugen eben nicht als Propheten, das zeigt das abschließende Kapitel „Beruf: Hellseher“. Gerade deshalb sind die Profis fürs Morgen so wichtig. Denn sie misstrauen jeder Vorhersage, die sie nicht selber erlogen haben, reden von Zukünften nur im Plural und jonglieren lässig mit allerlei widersprüchlichen „Zukünften“ – und kommen dennoch zu brauchbaren Vorhersagen. Sie machen vor, dass Medienkompetenz auch immer Märchenkompetenz ist.
Hightechmärchen sind Sprachspiele, interaktiv und bunt wie ein Videogame. Wer mit ihnen vertraut ist, kann die Schönsten von ihnen genießen, über die dümmsten von ihnen lachen und die gefährlichen als solche erkennen. Und der kann ihnen mit einem eigenen Märchen widersprechen. Die Informationsgesellschaft ist eine Erzählgemeinschaft, in der nicht die bessere Sache gewinnt, sondern die besser erzählte. Und wenn die Hightech-Märchenonkels- und Tanten nicht gestorben sind, erzählen sie noch morgen.